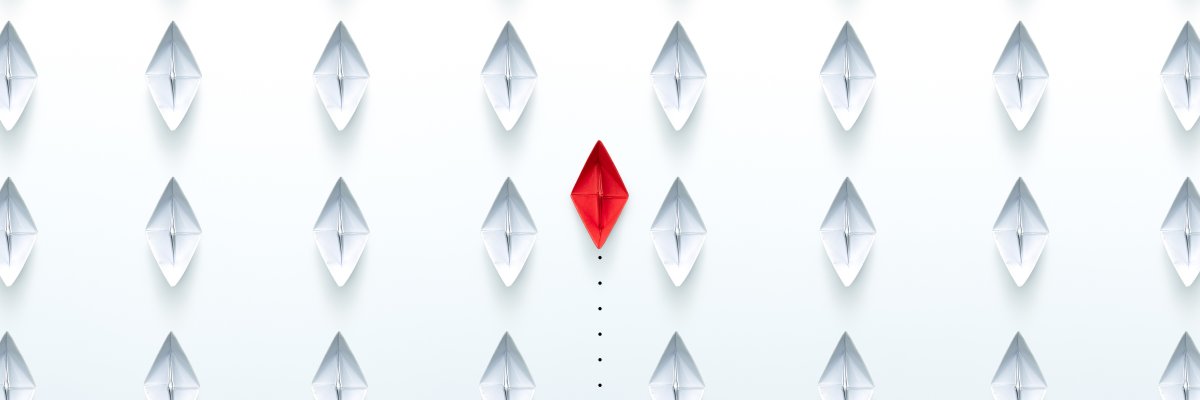Roland Schäfer, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), eröffnete die Veranstaltung und ging zunächst explizit auf die unter dem Kürzel „ÖPP“ oder „PPP“ bekannten Partnerschaften von privater Wirtschaft und öffentlicher Hand ein. Dazu skizzierte er die aktuelle Lage der deutschen Kommunen. Finanziell, so Schäfer, gehe es den Kommunen in ihrer Mehrheit inzwischen deutlich besser. 2006 konnte ein absolutes Rekordergebnis aus der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Außerdem seien im kommunalen Bereich mehr Einnahmen als Ausgaben zu verbuchen gewesen, so dass ein positives Finanzsaldo als Ergebnis stehe. Schätzungen prognostizierten dies auch für 2007. Zudem sei die Investitionsquote der Kommunen nach jahrelangem Sinken wieder gestiegen, nachdem sie über Jahre rückläufig war. „Also alles Gold?“, stellte Schäfer die Frage ans Plenum und beantwortete sie sogleich mit einem entschiedenen Nein. Denn: In vielen Städten und Gemeinden sei der Gewerbsteueranstieg bislang nicht angekommen. Zudem seien stark unterschiedliche Verteilungen zwischen den Bundesländern sowie negative Verteilungen innerhalb der Länder zu beobachten. „Viele Kommunen haben weiterhin Probleme. Es gilt, über den Beschaffungsansatz nachzudenken“, sagte Schäfer. In diesem Kontext sei die Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Partnern ein denkbarer Lösungsansatz. Allerdings solle man ÖPP nicht als reine Finanzierungsvariante begreifen. Sie brächten privates Know-how, privates Wissen und private Effizienz in öffentliche Projekte hinein und können damit von reinen Finanzierungsfragen auch zu einer Leistungs- und Ergebnisverbesserung führen. „ÖPP ist aber kein Allheilmittel, sondern eine weitere Beschaffungsvariante, die in bestimmten Fallkonstellationen sinnvoll ist“, resümierte Schäfer.
Lösungsmodell des Bundes: Partnerschaften Deutschland Gesellschaft
Um genau solche Fallkonstellationen richtig einschätzen und entsprechend handhaben zu können, plant der Bund die Gründung einer Beratungsgesellschaft nur für die öffentliche 21 Hand. Hierüber informierte auf dem 8. Deutschlandforum Verwaltungsmodernisierung Klaus Kubbetat, Regionalvorstand der Commerzbank AG. Die „Partnerschaften Deutschland Gesellschaft“ (PDG) beruht auf einer Idee der Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD), die diese dem Bundesministerium für Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vorgeschlagen hat. Nach dem Vorbild der britischen Institution „Partnership UK“ soll die PDG als Beratungsgesellschaft der öffentlichen Hand Unterstützung auf allen förderalen Ebenen leisten. Warum aber werden in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern, wie etwa Großbritannien, ÖPP eher zögerlich eingegangen? Teilweise so Kubbetat, beruhe dies auf einem mangelnden Erfahrungsschatz. „Die öffentliche Hand kennt den mit dem Einsatz privaten Eigenkapitals verbundenen Versicherungsanreiz und Überwachungsgedanken in dieser Form nicht. Daher erfolgt der Risikotransfer in Projekten häufig ohne konkrete Wertvorstellung zu dem jeweiligen Risiko. Der Preis des Risikotransfers wird über den Wettbewerb ermittelt. Dies stellt aber nicht zwangsläufig sicher, dass dieser Preis auch tatsächlich das bestehende Risiko exakt abbildet. Diese Risikokosten für privates Kapital werden bisher weder von der öffentlichen Hand, noch von den privaten Investoren problematisiert.“ Generell, so Kubbetat weiter, fehlten bei den in Deutschland bisher umgesetzten ÖPPProjekten auch Standards, die bei diesem Beschaffungsweg für Transparenz und Effizienz sorgen. Die PDG soll die grundlegenden Standards für ÖPP schaffen und dort, wo es sinnvoll erscheint, ÖPP als ernsthafte Alternative zur traditionellen Beschaffung etablieren. Dabei wird schon die PDG selbst als ÖPP gestaltet sein. „Durch diese Verknüpfung der öffentlichen mit der privaten Sichtweise bei erkennbarer Nähe zur öffentlichen Hand kann die PDG ihre Ziele in der Beratung optimal erfüllen“, erklärte Kubbetat. Ein Schwerpunkt der PDG werde die Frühphasenberatung sein, da sie eine vom bestehenden Beratungsmarkt kaum geleistete Aufgabe darstellt. In Einzelfällen könne sie aber auch die weiteren Phasen einer ÖPP begleiten, um aus konkreten Projekten die praktischen Schlüsse für wirksame Konzepte zu erarbeiten. Sobald die Standardisierung von Konzepten erreicht ist, werde der Arbeitsschwerpunkt der PDG sich auf das Thema Qualitätssicherung verlagern, denn, so betonte Kubbetat, die PDG wolle den bestehenden Beratermarkt nicht ersetzen oder gar verdrängen. Im Anschluss ging Kubbetat näher auf die Konzeption der PDG ein, die sich durch einen Mehrheitsbesitz der öffentlichen Hand auszeichnet. Dies wurde von den Initiatoren als wichtiger vertrauensbildender Schritt angesehen. Die PDG wird ferner als Aktiengesellschaft geführt. Diese Gesellschaftsform ermöglicht es, nicht nur im Tagesgeschäft die notwendige Distanz zur Politik zu bewahren, sie erleichtert auch die vergleichsweise unkomplizierte Aufnahme privater Gesellschafter. Mit ihren Gesellschaftern aus dem Kreis der öffentlichen Hand wird die PDG einen Dienstleistungsvertrag schließen; die Auswahl der privaten Gesellschafter erfolgt zusammen mit der europaweiten Ausschreibung dieses Dienstleistungsvertrages. Die Beteiligung der Privaten erfolgt hierbei mittelbar über eine Beteiligungsgesellschaft, die Auswahl schließlich über ein Losverfahren. So wird gewährleistet, dass sich möglichst alle interessierten privaten Investoren an der PDG beteiligen können und diese Beteiligung nicht nur von einigen wenigen, kapitalstarken Gesellschaftern dominiert wird. „Die PDG hat nicht die Zielsetzung, gewinnorientiert zu arbeiten, sondern sie muss sich wirtschaftlich selbst tragen. Daher sind die Anforderungen an die Investoren nicht alleine auf die Bereitschaft fokussiert, Eigenkapital in die Gesellschaft einzubringen. Vielmehr sind auch die Erfahrungen dieser privaten Investoren mit PPP und ihre Bereitschaft, die PDG bei der Fortentwicklung der PPP-Standards unterstützen zu wollen, wichtige Entscheidungsfaktoren für einen Zuschlag“, so Kubbetat abschließend.
Von wegen traditionell: Großbritannien macht’s vor
Was in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, wird in Großbritannien schon seit Längerem erfolgreich praktiziert. Erste Anreize für umfassende Kooperationen der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen gibt es auf der Insel schon seit Anfang der 1980er- Jahre. Über ein Vorzeigeprojekt berichtete Rainer Majcen, General Manager bei der arvato government services (ERYC) Ltd. Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende arvato direct services GmbH ist das führende Dienstleistungsunternehmen im Management von Kundenbeziehungen in Europa und außereuropäischen Märkten. Als privater Partner hat das Unternehmen zahlreiche Verwaltungsprozesse des in Mittelengland gelegenen East Riding of Yorkshire Council übernommen und dafür eigens die Gesellschaft arvato government services gegründet. Im Rahmen der ÖPP übernimmt arvato diverse Aufgaben bis hin zur Berechnung von Steuern und dem Zahlungseinzug sowie die Betreuung des IT-Sektors. Wie kam es dazu? Über eine europaweite Ausschreibung hatte sich der Kreisrat von East Riding 2002 auf die Suche nach einem privaten Partner gemacht mit dem Wunsch, zukünftig wirtschaftlicher und bürgerorientierter arbeiten zu können. Ziel war es, in puncto Dienstleistungen zu den zehn stärksten Councils in Großbritannien zu gehören – bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten. Vom privaten Partner versprach sich das Council Zugang zu Expertise und Technologien. Nach einer Ausschreibungsphase von drei Jahren erhielt arvato schließlich den Zuschlag für einen 8-Jahresvertrag. „East Riding ist in Bezug auf die Größe ein außergewöhnlicher Kreis. Wenn man von Nordwesten nach Südosten mit dem Auto fährt, braucht man gut 1,5 Stunden. 130.000 Haushalte und 320.000 Einwohner gibt es im Council, 3.000 Kilometer Straße durchziehen den Kreis und 159 Schulen werden betreut“, erklärte Majcen. Die Grundlage der ÖPP bilden drei Kernbereiche. Zunächst ist da das Dienstleistungsportfolio. Hierzu wurde die arvato governmernt services Vertragspartner des Kreises. arvato übernahm über 500 Mitarbeiter des Kreises, die Arbeit wird weiterhin vom Kreisgebäude aus geleistet. Zu den übernommenen Leistungen gehören u.a. der Einzug von lokalen Steuern, die Bearbeitung von Steuerabschlägen, die Einrichtung von Bürgerbüros, die IT-Entwicklung oder die Schulung neuer Mitarbeiter. Zweiter Kernbereich ist die gemeinsame Vermarktung von Dienstleistungen der Verwaltung in Form eines Joint Ventures zwischen dem Council und arvato. Die unternehmerische Führung sowie Finanzierung liegt bei arvato, das Council bringt sein Marktwissen und seine Netzwerke ein. Über Dividendenzahlungen und den Verkauf von Beratungsleistungen an das Joint Venture entstehen dem Council Einkommensströme, die ohne die Partnerschaft mit arvato nicht realisierbar gewesen wären. Und zu guter Letzt besteht die Vereinbarung, gemeinsam an der Entwicklung des Councils zu arbeiten. arvato stellt hier erfahrene Prozessberater für jene Bereiche bereit, die nicht ausgegliedert wurden. Außerdem arbeitet der private Partner eng mit den lokalen Schulen zusammen. Das ÖPP-Projekt in East Riding hat auch in Deutschland Aufmerksamkeit erregt. Es wurde mit dem Sonderpreis zum Innovationspreis PPP 2006 – ausgeschrieben vom Behördenspiegel und dem Bundesverband PPP – ausgelobt. Für arvato government services selbst ist das Projekt in Yorkshire ein „Schaukasten“, in dem das gesamte Leistungsspektrum zu sehen ist. Das Unternehmen möchte zukünftig ihr ÖPP-Modell auch den Kommunen in Deutschland näher bringen.
Chance oder Bedrohung: Web 2.0
Ein weiteres spannendes Thema für die Kommunen sind die Möglichkeiten, die das Internet bzw. das interaktive Web 2.0 für Städte und Gemeinden bereithält. Zu diesem Thema hatte der IC Tatjana Brode eingeladen, Journalistin bei der Bundeszentrale für politische Bildung und dort auch verantwortlich für den Internetauftritt. Unter dem Titel „Das Netz revolutioniert auch die deutsche Politik“ informierte sie über die Internetnutzung in Deutschland und über die Rolle des Webs in der politischen Kommunikation, insbesondere über die Potenziale für die Kommunalpolitik. Der Vortrag steht hier zum Download bereit Ergänzend fand im Anschluss die Expertendiskussion vor dem Plenum statt. Neben Tatjana Brode begrüßte Moderator Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des DStGB, auch Christoph Meinecke. Mit 27 Jahren wurde dieser in der Gemeinde Wennigsen zum jüngsten Bürgermeister Niedersachsens gewählt. Meinecke kehrte nach seinen VWL-Studium nach Wennigsen zurück und setzte für seinen Wahlkampf auch das Web 2.0 als Mittel ein. So sollten die potenziellen Wähler die Möglichkeit haben, den „abstrakten“ Kandidaten, den sie nur durch die Zeitung kennen, sofort kontaktieren zu können. „Gleich an dem Tag, an dem ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe, habe ich meine Homepage freigeschaltet. Wir hatten lange daran gearbeitet und Elemente wie Weblogs und Chats mit eingearbeitet. Nach einer kurzen Phase der Euphorie folgte allerdings Ernüchterung. Die Wähler waren nicht bereit dafür, dieses Instrument zu nutzen, vermutlich weil man nicht damit umgehen konnte oder wollte“, berichte Meinecke über seine Erfahrungen. Auf die Nachfrage, ob die bereitgestellte Website denn dazu geführt habe, dass andere sich für ihn engagiert haben, sagte Meinecke: „Das lief nicht über meine Homepage, sondern über Online-Communities. Hier haben Leute angefangen, meinen Wahlkampf weiterzuführen und, ähnlich wie bei Wikipedia, Textelemente aus meiner Hompepage kopiert, verbreitet, mit zusätzlichen Inhalten angereichert und so auch für ein kritisches Hinterfragen geöffnet. So hat mein Wahlkampf quasi ein virtuelles Eigenleben bekommen.“ Meinecke war sich darüber hinaus sicher, dass die informellen Aktivitäten im Web dazu beigetragen haben, dass er als Kandidat anders wahrgenommen wurde. „Wenn der Wahlkämpfer nicht selbst kommuniziert, sondern wenn Leute in bestimmten Altersgruppen die Wähler ansprechen, wenn z.B. ein 16-Jähriger mit einem 16-Jährigen, der zum ersten Mal wählen darf, über den Kandidaten spricht und quasi als eine Art Pate für den Kandidaten eintritt, dann bewirkt das schon etwas“, so der Wennigser Bürgermeister. Wie sehr das Web 2.0 den Wahlkampf beeinflussen kann, würde u.a. durch die USA gezeigt werden, führte Franz-Reinhard Habbel die Diskussion fort. So habe beispielsweise Hillary Clinton ihre Präsidentschaftskandidatur im Internet bekannt gegeben. Und ein von Bürgern erstelltes Youtube-Video des „Obama Girls“, eines leichtbekleideten Top-Modells, das für den Kandidaten Barack Obama wirbt, wurde bereits über 6 Millionen Male angeklickt. „Wird sich diese nationale Entwicklung auch auf die regionale Ebene runterbrechen? Müssen Bürgermeister in Deutschland zukünftig damit rechnen, über Youtube-Videos bespielt zu werden?“, lautete die Frage an Tatjana Brode. Deutschland sei diesbezüglich sicherlich nicht vergleichbar mit den USA. Davor gefeit, sich in einem Youtube-Video wieder zu finden, sei allerdings auch hierzulande niemand mehr, so die Meinung der Journalistin. „Die jüngeren Menschen sind durch entsprechende Geräte, wie z.B. Handys so ausgestattet, dass sie jederzeit Dinge aufnehmen und auch veröffentlichen können. Das ist ein Teil der Transparenz, mit der man leben muss. Darüber hinaus ging Tatjana Brode noch einmal darauf ein, wie Online-Communities beim Wahlkampf helfen können. „Es ist so, dass sich auch lokal nach und nach Communities organisieren. Und das wird sogar forciert, z.B. arbeiten Zeitungen an Projekten, die bis in die lokale Ebene runtergehen und versuchen, Leute vor Ort zu mobilisieren, Geschichten aus ihrem direkten Umfeld zu erzählen. Wenn man es als Kommunalpolitiker schafft, in diese lokalen Netzwerke reinzukommen und ein Gesprächthema zu sein, dann kann das beim Wahlkampf helfen.“ Dabei könne nach Meinung der Journalistin auch die Website eines Kommunalpolitikers helfen, sofern sie so aufgebaut sei, das Inhalte gut an andere weitergegeben werden können, und interessierte Blogger oder Communities die Möglichkeit haben, mit den Inhalten an anderer Stelle weiter zu diskutieren. Ob denn die zunehmende Mobilisierung des Internets eine Bedrohung für Verwaltung und kommunale Politik sei, wollte Habbel weiterhin wissen. „Wie gehen Kommunen mit Websites um, auf denen Bürger mobil machen, z.B. für Kindertagestätten? Sind Politiker darauf vorbereitet, Antworten zu geben, oder sind solche Websites eher eine Bedrohung?“ Hierzu bezog Meinecke Stellung: „Für die Verwaltung sehe ich keine Bedrohung. Wir sollten differenzieren zwischen dem so genannten Web 1.0., wo man reinklickt, um Infos zu holen und dem Web 2.0. Im Web 1.0 kann die Verwaltung einen guten Service für die Bürger vorhalten. Das Interessante für die lokale Politikgestaltung sind vielmehr die vielen kleinen Foren. Das Web 2.0 ist ein Art Kaffeehaus oder ein Stammtisch. Man geht hier nicht nur hin, um sich Infos zu holen, sondern auch, um gesehen zu werden, um Informationen zu verbreiten. Die Frage ist: Wie weit wird es uns als Kommunalpolitikern gelingen, diese Foren mitzuverfolgen, wie viel Zeit werden wir aufwenden können? Welche Strukturen wird es geben? Wo hole ich mir die Infos, auf welchen Drähten kommuniziere ich mit dem Bürger? Das ist die eigentliche Herausforderung an die kommunale Politik.“
Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen?
Im Anschluss an die Expertendiskussion zogen sich die Teilnehmer des 8. Deutschlandforums Verwaltungsmodernisierung in die erste Workshopphase zurück. In drei Arbeitsgruppen diskutierten die IC-Mitglieder zu weiteren Schwerpunkthemen. Diese lauteten „Public Private Partnerships – eine strategische Option in der Kommunalveraltung“, „Schuldenmanagement“ und „Aktive Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger über WEB 2.0“. Am Abend des ersten Veranstaltungstages stand dann das mittlerweile traditionelle Kamingespräch auf dem Programm. Dieses Mal hatte der IC Dr. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Weltbevölkerung und globale Entwicklung eingeladen. Unter dem Titel „Die demografische Lage der Nation. Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen?“ zeichnete er ein kritisches Bild. Die vom Berlin-Institut durchgeführte Studie bewertete sämtliche Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands anhand von 22 Indikatoren zur demografischen und sozialen Lage. Indikatoren waren unter anderem Kinderzahlen, Altersverteilung, Wanderungsbewegungen, Ausbildungsstand oder Industriestatus. Die Untersuchung ergab u.a.: Deutschlandweit sinkt die Zahl der unter 35-Jährigen. So gibt es in Deutschland eine wachsende Konkurrenz der Regionen um produktive junge Menschen. Aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung in den einzelnen Bundesländern haben sich Hunderttausende auf die Wanderschaft gemacht. Darunter leiden vor allem jene Regionen, die ohnehin schon Probleme haben, während die Wachstumsgebiete von der Binnenmigration noch profitieren. Der Wettbewerb der Regionen verschärft sich weiter. Das Fazit der Studie ergab außerdem, dass sich die süddeutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern als am zukunftsfähigsten erweisen. Eine moderne innovative Wirtschaft lockt dort seit Jahrzehnten Zuwanderer aus dem In- und Ausland an. In Baden-Württemberg liegen allein 12 der 20 zukunftsfähigsten Kreise. Auch Bayern ist mit sieben Kreisen gut vertreten, allerdings weist der Freistaat an seinen Grenzen erkennbare Problemzonen auf. So sind zahlreiche bayerische Grenzkreise, vor allem in Oberfranken, bereits in einen demografischwirtschaftlichen Abwärtsstrudel geraten. Besonders kritisch ist die Lage vielerorts in den neuen Bundesländern. Seit 15 Jahren verlassen junge Menschen den Osten. Selbst Kreise, in denen die Wirtschaftlichkeit deutlich wächst, können demografisch kaum profitieren. Die Kommunen bleiben bei sinkenden Einnahmen auf den hohen Kosten einer häufig überdimensionierten Infrastruktur sitzen und können oftmals nur durch weitere Verschuldung ihre laufenden Kosten decken. Inseln der Stabilität finden sich in den neuen Bundesländern ausschließlich im Umfeld wichtiger Großstädte wie Berlin, Dresden oder Leipzig. „Die Menschen machen somit vor, was die Politik erst langsam erkennt. Das sich angesichts des massiven Bevölkerungsrückgangs von alleine Leuchttürme, Zentren oder Kerne herausbilden, in denen der Erhalt wichtiger Infrastruktur lohnt“, resümierte Dr. Klingholz am Ende seines Vortrags. Die gesamte Studie mit allen Ergebnissen im Detail kann unter www.berlin-institut.org bestellt werden.
Kommunen nutzen Energieeinsparpotenziale nicht ausreichend
Am zweiten Veranstaltungstag griff der IC ein Thema auf, welches bereits auf dem 7. Deutschlandforum Verwaltungsmodernisierung im April 2007 auf der Tagesordnung stand: „Kommunale Energieeinsparpotenziale durch Gebäudesanierung und intelligenten Energieeinsatz im Dienstleistungssektor“. Felicitas Kraus, Bereichsleiterin Energieeffizienz im Gebäudebereich der Deutschen Energie-Agentur GmbH informierte das Plenum über die Angebote, die die dena für Kommunen bereithält. „Städte und Gemeinden“, so erläuterte Kraus zu Beginn ihres Vortrags, „sind die größten Liegenschaftsbesitzer. Niemand weiß genau, wie viele Gebäude sich bundesweit in kommunaler Hand befinden, daher hatte die dena das Forschungsunternehmen prognos für eine Schätzung beauftragt. Demnach lagen die Energiekosten von Kommunen im Jahr 2005 bei 3,6 Milliarden Euro. Eine Hochrechnung für 2007 ergab eine Summe von 4,1 Milliarden Euro. Ein Grund für diese hohen Kosten sieht Kraus darin, dass bei der Anschaffung von Immobilien vorrangig nur die Investitionskosten betrachtet werden. Das gelte übrigens sowohl für Investoren aus dem privaten Sektor als auch aus dem Bereich der öffentlichen Hand. „Zudem gibt es auch im Nichtwohnbereich hohe Energieeinsparpotenziale, die nicht genutzt werden. Bei Modernisierungen werden zum Beispiel im Durchschnitt nur ein Drittel der Möglichkeiten genutzt“, so Kraus. Dies sei nicht nur im Hinblick auf Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit kritisch zu betrachten. Kommunen hätten auch eine Vorbildfunktion: „Man ist wenig glaubwürdig, wenn man den Bürgern predigt, sie sollen Energie sparen, es aber in den eigenen Liegenschaften versäumt oder vernachlässigt.“ Die dena hat Angebote speziell für Kommunen entwickelt, wie z.B. das Projekt „Niedrigenergiehaus im Bestand für Schulen“ oder „Energieeffiziente Sanierung von Nichtwohngebäuden“. Zudem unterstützt die dena Bund, Länder und Kommunen bei der Entwicklung und Durchführung von Contracting-Ausschreibungen. Ausführliche Informationen über ihre Dienstleistungen für Kommunen hält die dena auf ihrer Website www.dena.de bereit.
Experten fordern mehr Tatkraft
Im Anschluss an das Impulsreferat von Felicitas Kraus lud Franz-Reinhard Habbel zu einer weiterführenden Expertenrunde. Neben Felicitas Kraus hatten sich Klaus Grabbe, Bürgermeister der Stadt Neckarsulm, Dr. Michael Zinke, Referatsleiter im Bundeswirtschaftsministerium und Jörg Mayer, Geschäftsführer der Informationskampagne für Erneuerbare Energien, als Diskutanten eingefunden. In seiner ersten Frage wies Habbel auf eine Schieflage bei der Diskussion um Energieeinsparpotenziale hin. Das Thema „Tempo 130 auf Autobahnen“ werde heftig diskutiert, obwohl es letztendlich weniger als ein Prozent Einsparung bringe. „Die großen Einsparpotenziale liegen bei der Industrie und natürlich auch bei den Gebäuden und Haushalten. Warum werden diese nicht von der Politik entsprechend aufgenommen?“, lautete die Frage an die Expertenrunde. „Das Thema Energieeffizienz ist nicht ganz so sexy wie die Diskussionen zum Tempolimit von 130 km/h. Es ist auch nicht so sichtbar, weil es aus einem Bündel kleiner Maßnahmen und nicht aus einem schönen großen Windrad besteht“, so Kraus. „Jeder redet über den Klimaschutz und den regenerativen Energieeinsatz, aber die wenigsten tun etwas. Deswegen muss die Leistungsfähigkeit der Kommunen auch in finanzieller Hinsicht gestärkt werden. Und es muss in den Kommunen mehr Köpfe geben, die bereit sind, selbigen aus dem Fenster zu halten. Man muss auch Projekte machen, die mit Risiko verbunden sind!“, forderte Grabbe. Einen weiteren Aspekt brachte Dr. Zinke ein: „Viele wissen zu wenig. Das Energiesystem ist komplex. Die große Masse der Bevölkerung hat dieses System und vor allen Dingen die gegenwärtig dramatischen Veränderungen noch gar nicht durchschaut.“ Und Maier folgerte daraufhin: „Wir müssen die Kommunen darüber aufklären – unter Einbeziehung aller Vor- und Nachteile – wie man sich heute mit erneuerbaren Energien selbst versorgen kann.“ Danach leitete Habbel auf das Thema E-Energy über. „Ich habe gelesen, dass die Kilowattstunde intelligent gemacht werden soll. Was heißt das genau? Welche Potenziale liegen dort und wie können wir uns dieses Thema greifen? „Wenn Sie das Gesamtsystem der erneuerbaren Energien betrachten, dann hatten wir es bisher mit dem Paradigma der verbrauchsorientierten Erzeugung zu tun. Dieses Paradigma kann aber mit Wind und Sonne nicht aufrecht erhalten werden. Es kommt daher das Paradigma des erzeugungsorientierten Verbrauchs hinzu. Und dies ist nicht ohne Informations- und Kommunikationstechnologie zu realisieren. Es gilt, aus dem Gesamtsystem ein System von kommunizierende Röhren zu machen, so dass z.B. das erste Windrad mit der letzten Waschmaschine intelligent vernetzt ist“, erläuterte Dr. Zinke, der damit auch auf ein Projekt des BMWi hinwies. Im April 2007 wurde der Technologiewettbewerb E-Energy gestartet. Mit dem Wettbewerb soll die Entwicklung und Erprobung von integrierten Konzepten zum Aufbau von etwa drei bis fünf E-Energy-Modellregionen gefördert werden. Dabei handelt es sich um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die in einem regionalen Innovationscluster die Modernisierungspotenziale fortgeschrittener Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) sowie darauf basierender Anwendungen und Dienste in der gesamten Wertschöpfungskette der Stromversorgung – von der Erzeugung über Transport und Verteilung bis hin zum Verbrauch – erschließen. Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde das Thema Energieeffizienz in Kommunen noch einmal unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachtet. Grabbe bezog Stellung: „Im Umfeld einer Kommune haben wir es im Durchschnitt mit 80 Prozent Altbausubstanz zu tun. Das bedeutet 400 Kilowatt pro Quadratmeter und das ist in allen Städten die Praxis. Davon müssen wir runter kommen.“ Laut Grabbe müssen Kommunen dafür auch selbst Pilotprojekte durchführen und versuchen, Entscheidungsträger und Multiplikatoren in der Gesellschaft ins Boot zu holen. Das sei eine Aufgabe, die eine Kommune gut leisten könne. Zum Ende der Expertenrunde gab Jörg Maier noch einmal einen kurzen Überblick über Erfolge und Probleme in Bezug auf den Ausbau von erneuerbaren Energien. Im Gegensatz zum Strommarkt hinke man bei der Erreichung der EU-Zielvorgaben auf dem Wärmemarkt noch hinter her. Da aber der Wärmeanteil am Gesamtenergiebedarf in Deutschland über 50 Prozent liegt, müsse hier noch einiges investiert werden. Das gelte auch für den Treibstoffbereich. Detailliert ging Maier dann noch auf den Ausbau von Windparks ein. Es gäbe noch keine Technologie in Deutschland, durch die man einen kompletten, funktionstüchtigen Windpark in die See stellen könne. Auf dem Land, wo diese Parks kostengünstiger realisiert und der Windstrom günstiger produziert werden könnte, seien die Flächen knapp. Darüber hinaus seien die Widerstände, gerade auch von kommunaler Seite, gegenüber Windparks groß. Den Schlussappell lieferte Grabbe: „Eines ist klar, die fossile Zukunft gibt es nicht. Es gibt nur eine regenerative Zukunft, da sind sich alle einig. Und nur wir können versuchen, dass unsere Wirtschaft diesen Übergang verträgt. Denn wir werden feststellen, dass man weniger reisen wird, weil das Benzin zu teuer ist. Wir werden feststellen, dass man weniger Energie verbrauchen muss, weil sie nicht mehr so leicht zu bezahlen ist wie früher. Energie ist einfach ein betriebswirtschaftlicher Faktor.“ Der Nachmittag des zweiten Veranstaltungstages gehörte wieder den Arbeitsgruppen, in denen das Thema Kommunen und Energie noch einmal vertiefend diskutiert wurde. Sobald die Ergebnisse in Thesenpapieren vorliegen, werden sie an dieser Stelle zum Download bereitgestellt.
8. Deutschlandforum